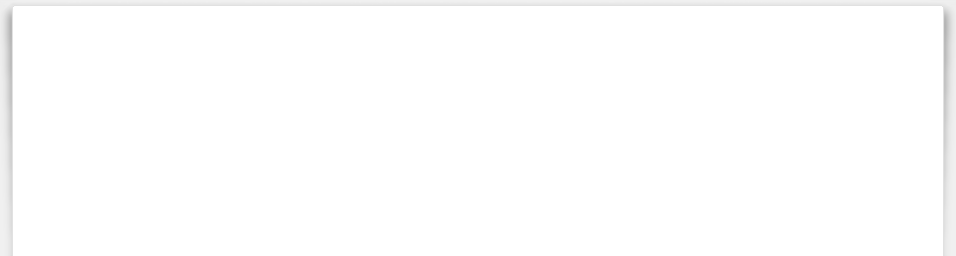
Investition
> Statische Methoden


12.90 EUR


Rentabilitätsrechnung
Text zum Video
Die Kosten - und Gewinnvergleichsrechnungen haben uns die Grundlagen für die Betrachtung der Rentabilitätsrechnung geliefert.
Im Vorhergehenden haben wir uns die Frage gestellt: "was kostet uns die Produktion?"
und "welchen Gewinn erzielen wir?". Was wir bisher noch nicht betrachtet haben, ist die Frage
"wie ist das Verhältnis zwischen Kosten und Gewinn?". Diese Frage bezeichnet man auch als die Frage nach der
"Kapitalbindung" einer Investition. Als "gebundenes Kapital" bezeichnet man per Definition
"die in einem Unternehmen langfristig nicht freisetzbaren Vermögensgegenstände".
Je teurer also der Anschaffungspreis der Maschine ist, desto mehr Kapital ist "eingebunden" und
steht für die Dauer der Kapitalbindung nicht mehr für andere Investitionen zur Verfügung.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Aspekt in die Bewertung einer Investition einfließen muss, wenn wir uns die Frage nach der Rentabilität zweier Investitionen stellen. Die Rentabilität stellt also "die Relation zwischen Gewinn und eingesetztem Kapital" dar. Vor diesem Hintergrund betrachten wir nun unsere geplante Espressoproduktion erneut. Wir führen uns die in der Gewinnvergleichsrechnung ermittelten Daten noch einmal vor Augen. Bei einer Produktionsmenge von 900.000 Espressopäckchen pro Jahr fielen jährliche Kosten in Höhe von 870.000 Euro für Anlage A und 1.010.000 Euro für Anlage B an. Die jährlichen Gewinne betrugen 300.000 Euro bzw. 340.000. Welche von beiden Maschinen arbeitet rentabler? Die Rentabilität, auch kurz "R" genannt erhalten wir, indem wir den Gewinn "G" der Anlage durch die Kosten "K" dividieren. [Rechnung darstellen] Hieraus ergibt sich für Anlage A ein Wert von ca 34,5 Prozent, dagegen für Anlage B ein Wert von ca 33,7 Prozent. Obwohl Anlage A einen geringeren Gewinn erwirtschaftet, ist ihre Rentabilität höher. Dies liegt an der Tatsache, dass Anlage B im Verhältnis zum Gewinn mehr Kapital beansprucht als Anlage A. Wir entscheiden uns nach der Rentabilitätsmethode also für Anlage A.
Abschließend lässt sich festhalten: Die Aussagen der Rentabilitätsrechnung sind prägnanter als bei den beiden zuvor genannten Methoden. Die Berechnung der absoluten Vorteilhaftigkeit ist ein starkes Argument für den Einsatz der Rentabilitätsrechnung. Wie es auch bei den vorhergehenden Methoden der Fall war, lassen sich die beiden Größen "Kosten" und "Erlöse" in der Praxis zum Teil schwer ermitteln. Die Rentabilitätsrechnung wird dennoch recht häufig eingesetzt und ist für den Betriebswirt ein leicht anzuwendendes Hilfsmittel für den Vergleich zweier Investitionen.
Es liegt auf der Hand, dass dieser Aspekt in die Bewertung einer Investition einfließen muss, wenn wir uns die Frage nach der Rentabilität zweier Investitionen stellen. Die Rentabilität stellt also "die Relation zwischen Gewinn und eingesetztem Kapital" dar. Vor diesem Hintergrund betrachten wir nun unsere geplante Espressoproduktion erneut. Wir führen uns die in der Gewinnvergleichsrechnung ermittelten Daten noch einmal vor Augen. Bei einer Produktionsmenge von 900.000 Espressopäckchen pro Jahr fielen jährliche Kosten in Höhe von 870.000 Euro für Anlage A und 1.010.000 Euro für Anlage B an. Die jährlichen Gewinne betrugen 300.000 Euro bzw. 340.000. Welche von beiden Maschinen arbeitet rentabler? Die Rentabilität, auch kurz "R" genannt erhalten wir, indem wir den Gewinn "G" der Anlage durch die Kosten "K" dividieren. [Rechnung darstellen] Hieraus ergibt sich für Anlage A ein Wert von ca 34,5 Prozent, dagegen für Anlage B ein Wert von ca 33,7 Prozent. Obwohl Anlage A einen geringeren Gewinn erwirtschaftet, ist ihre Rentabilität höher. Dies liegt an der Tatsache, dass Anlage B im Verhältnis zum Gewinn mehr Kapital beansprucht als Anlage A. Wir entscheiden uns nach der Rentabilitätsmethode also für Anlage A.
Abschließend lässt sich festhalten: Die Aussagen der Rentabilitätsrechnung sind prägnanter als bei den beiden zuvor genannten Methoden. Die Berechnung der absoluten Vorteilhaftigkeit ist ein starkes Argument für den Einsatz der Rentabilitätsrechnung. Wie es auch bei den vorhergehenden Methoden der Fall war, lassen sich die beiden Größen "Kosten" und "Erlöse" in der Praxis zum Teil schwer ermitteln. Die Rentabilitätsrechnung wird dennoch recht häufig eingesetzt und ist für den Betriebswirt ein leicht anzuwendendes Hilfsmittel für den Vergleich zweier Investitionen.
Inhalt

 Einführung
Einführung 
 Was bedeutet Investition
Was bedeutet Investition 
 Ãœbung 1
Ãœbung 1 
 Arten von Investitionen
Arten von Investitionen 
 Ãœbung 2
Ãœbung 2 
 Statische Methoden
Statische Methoden 
 stat. Methoden: sinnvoll?
stat. Methoden: sinnvoll? 
 Kostenvergleichsrechnung
Kostenvergleichsrechnung 
 Ãœbung 3
Ãœbung 3 
 Gewinnvergleichsrechnung
Gewinnvergleichsrechnung 
 Ãœbung 4
Ãœbung 4 
 Rentabilitätsrechnung
Rentabilitätsrechnung 
 Ãœbung 5
Ãœbung 5 
 Amortisationsrechnung
Amortisationsrechnung 
 Ãœbung 6
Ãœbung 6 
 Dynamische Methoden
Dynamische Methoden 
 Finanzmathematik
Finanzmathematik 
 Ãœbung 7
Ãœbung 7 
 Kapitalwertmethode
Kapitalwertmethode 
 Ãœbung 8
Ãœbung 8 
 interner Zinsfuß
interner Zinsfuß 
 Ãœbung 9
Ãœbung 9 
 Annuitätenmethode
Annuitätenmethode 
 Ãœbung 10
Ãœbung 10 
 dyn. Amortisationsrechnung
dyn. Amortisationsrechnung 
 Ãœbung 11
Ãœbung 11 
 Anwendung der Methoden
Anwendung der Methoden 
 Vorteilhaftigkeit
Vorteilhaftigkeit 
 Ãœbung 12
Ãœbung 12 
 Wahlproblem
Wahlproblem 
 Ãœbung 13
Ãœbung 13 
 Ersatzproblem
Ersatzproblem 
 Ãœbung 14
Ãœbung 14 
 optimale Nutzungsdauer
optimale Nutzungsdauer 
 Ãœbung 15
Ãœbung 15 
 Investitionsprogramme
Investitionsprogramme 
 Dean Modell
Dean Modell 
 grafische Darstellung
grafische Darstellung 
 Ãœbung 16
Ãœbung 16 
 Unsicherheit
Unsicherheit 
 Korrekturverfahren
Korrekturverfahren 
 Sensitivitätsanalyse
Sensitivitätsanalyse 
 weitere Lösungsansätze
weitere Lösungsansätze 
 Ãœbung 17
Ãœbung 17 
 Steuern
Steuern 
 Ãœbung 18
Ãœbung 18 
 Zusammenfassung
Zusammenfassung 




 Kapitel zurück
Kapitel zurück